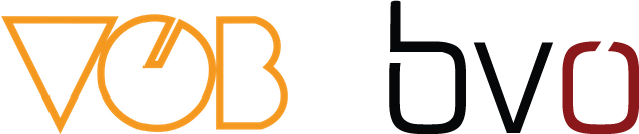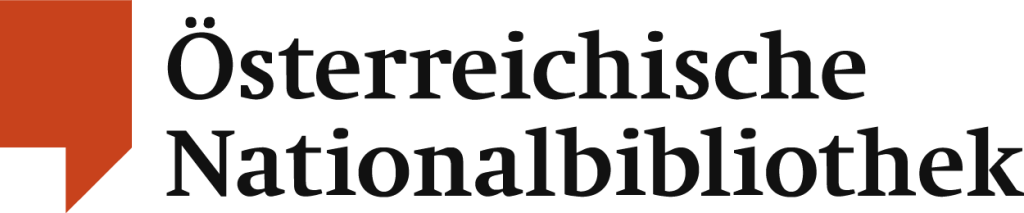Veranstalter

Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
Universitätsbibliothek der Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
E-Mail:
bibliothekskongress2025@voeb-b.at
.

Büchereiverband Österreichs
Mohsgasse 1/ 2.2
1030 Wien
Kongressorganisation

studio12 gmbh
Herr Tobias Zimmermann
Kaiser Josef Straße 9
6020 Innsbruck
E: zto@studio12.co.at
Organisationskomitee
Copyright © 2024 Congress Pilot GmbH | Datenschutzrichtlinie | Impressum